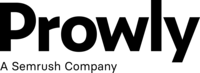Was die einen für die ideale Öko-Stadt der Zukunft halten, nennen andere einen Werbegag. Forschende des Complexity Science Hub zeigen nun, warum "The Line" kein Vorzeigeprojekt sein sollte.
Im Oktober begannen die Aushubarbeiten für das Bauprojekt der Superlative. "Sie ist die Verkörperung des Traums, eine Stadt von Grund auf neu zu konzipieren", sagt Rafael Prieto-Curiel, der am Complexity Science Hub Städte erforscht. The Line soll eine Stadt sein, gebaut aus dem Nichts inmitten der Wüste. Sie soll aus zwei gigantischen, ununterbrochenen Reihen von Wolkenkratzern bestehen, mit Raum zum Leben dazwischen. 170 Kilometer lang. 200 Meter breit. 500 Meter hoch und damit höher als jedes Gebäude in Europa, Afrika und Lateinamerika. Schnurgerade vom Roten Meer nach Osten.

ZEHNMAL SO DICHT WIE MANHATTAN
Neun Millionen Menschen sollen in ihr leben - mehr als in jeder anderen Stadt Saudi-Arabiens. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 265.000 Menschen pro Quadratkilometer - zehnmal dichter als Manhattan und viermal dichter als die inneren Bezirke von Manila, die derzeit als die dichtesten Stadtviertel der Erde gelten. "Wie man in einem mittelgroßen Land überhaupt so viele Menschen anziehen will, bleibt abzuwarten", sagt Prieto-Curiel.
SECHZIG MINUTEN FÜR EINE STRECKE
Weitere Fragen stellen sich in Bezug auf die Mobilität. "Eine lineare Form ist die am wenigsten effiziente Form einer Stadt", betont Prieto-Curiel. "Es gibt einen Grund, warum die Menschheit 50.000 Städte hat, und alle mehr oder weniger rund sind", so der Wissenschafter.
Zwei zufällig ausgewählte Personen in The Line werden durchschnittlich 57 km voneinander entfernt sein. In Johannesburg, das flächenmäßig 50 Mal größer ist, sind zwei zufällige Personen nur 33 km voneinander entfernt. Geht man von einer Laufdistanz von einem Kilometer aus, leben nur 1,2 % der Bevölkerung fußläufig voneinander entfernt. Dies hemmt die aktive Mobilität, so dass die Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sein werden.
Zwei zufällig ausgewählte Personen in The Line werden durchschnittlich 57 km voneinander entfernt sein. In Johannesburg, das flächenmäßig 50 Mal größer ist, sind zwei zufällige Personen nur 33 km voneinander entfernt. Geht man von einer Laufdistanz von einem Kilometer aus, leben nur 1,2 % der Bevölkerung fußläufig voneinander entfernt. Dies hemmt die aktive Mobilität, so dass die Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sein werden.

a| Standort von The Line in Saudi-Arabien. b | Erwartete Pendelzeit (vertikal) in Abhängigkeit von der Anzahl der Stationen (horizontal). c | Größte Städte in Saudi-Arabien, einschließlich der geplanten Bevölkerung von The Line.
Das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs wird ein Hochgeschwindigkeitsbahnsystem bilden. "Damit alle Menschen eine Station zu Fuß erreichen können, muss es mindestens 86 Stationen geben", erklärt CSH-Forscher Dániel Kondor. Infolgedessen verbringen die Züge viel Zeit in den Bahnhöfen und sind nicht in der Lage, zwischen zwei Bahnhöfen hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Den Forschern zufolge würde eine Fahrt daher im Durchschnitt 60 Minuten dauern, und mindestens 47 % der Bevölkerung müssten sogar noch länger pendeln.
Selbst mit zusätzlichen Expresslinien verkürzt sich die Reisezeit wegen der zusätzlichen Umstiege nur begrenzt. Daher wären die Menschen auch dann noch länger unterwegs als in anderen Großstädten wie Seoul, wo 25 Millionen Menschen weniger als 50 Minuten pendeln.
Selbst mit zusätzlichen Expresslinien verkürzt sich die Reisezeit wegen der zusätzlichen Umstiege nur begrenzt. Daher wären die Menschen auch dann noch länger unterwegs als in anderen Großstädten wie Seoul, wo 25 Millionen Menschen weniger als 50 Minuten pendeln.
EINE STADT IST MEHR ALS EIN STADTTEIL
Untersuchungen zeigen, dass Menschen nur eine begrenzte Zeit mit Pendeln verbringen wollen, so dass effiziente Verkehrsmittel eine Schlüsselrolle für den Erfolg von Städten spielen. Können diese Fahrten durch die Stadt jedoch vermieden werden, weil die hohe Dichte es ermöglicht, dass alles (Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten, Annehmlichkeiten usw.) vor Ort verfügbar ist? "Städte sind mehr als eine Ansammlung von halb isolierten Vierteln, die im Abstand von 15 Minuten nebeneinander liegen. Was eine Stadt von kleineren Siedlungen unterscheidet, ist nicht nur ihre Größe, sondern vor allem die zusätzlichen Möglichkeiten außerhalb der unmittelbaren Nachbarschaft - wie Konzerte oder eine weitläufige Arbeitssuche. Aus diesem Grund müssen wir den stadtweiten Verkehr berücksichtigen", erklärt Kondor.
WARUM NICHT "THE CIRCLE"?
Würde man The Line zu The Circle formen, mit einem Radius von 3,3 Kilometern, betrüge die Entfernung zwischen zwei Personen nur 2,9 Kilometer, und 24 % der Bevölkerung wären fußläufig voneinander entfernt. Der Großteil der Mobilität könnte aktiv erfolgen (zu Fuß, mit dem Fahrrad oder ähnlichem), was ein Hochgeschwindigkeitsbahnsystem überflüssig machen würde. Außerdem könnte The Circle auch bei geringerer Bevölkerungsdichte eine gute Anbindung ermöglichen, so dass keine Hochhäuser erforderlich wären.
UND WAS IST DAS POSITIVE?
"Dieses Projekt bringt die Menschen dazu, über urbane Formen zu diskutieren, und das ist immens wichtig, denn die Städte, insbesondere in Afrika, wachsen", sagt Prieto-Curiel.
Außerdem betont das Projekt in vielen Aspekten die Nachhaltigkeit. So wird es beispielsweise für Entfernungen, die nicht mehr als fünf Minuten Fußweg erfordern, keine Autos geben. Das spart nicht nur viel Platz in Bezug auf Infrastruktur und Parkplätze, sondern reduziert auch die Anzahl der Autos. Außerdem wird die gesamte Energie CO2-neutral erzeugt. Unberücksichtigt bleibt dabei allerdings der Bau der Wolkenkratzer, der erhebliche Mengen an Material und Energie erfordert.
"Insgesamt gesehen liegt die Vermutung nahe, dass andere Erwägungen bei der Wahl dieser einzigartigen Form eine Rolle gespielt haben könnten, wie z. B. das Branding oder die Erstellung ansprechender Videos in den sozialen Medien. Es ist jedoch wichtig, die Konsequenzen zu verstehen, insbesondere wenn The Line als Vorzeigeprojekt für moderne Bau- und Stadtplanungstechnologien betrachtet wird", betont Prieto-Curiel.
Außerdem betont das Projekt in vielen Aspekten die Nachhaltigkeit. So wird es beispielsweise für Entfernungen, die nicht mehr als fünf Minuten Fußweg erfordern, keine Autos geben. Das spart nicht nur viel Platz in Bezug auf Infrastruktur und Parkplätze, sondern reduziert auch die Anzahl der Autos. Außerdem wird die gesamte Energie CO2-neutral erzeugt. Unberücksichtigt bleibt dabei allerdings der Bau der Wolkenkratzer, der erhebliche Mengen an Material und Energie erfordert.
"Insgesamt gesehen liegt die Vermutung nahe, dass andere Erwägungen bei der Wahl dieser einzigartigen Form eine Rolle gespielt haben könnten, wie z. B. das Branding oder die Erstellung ansprechender Videos in den sozialen Medien. Es ist jedoch wichtig, die Konsequenzen zu verstehen, insbesondere wenn The Line als Vorzeigeprojekt für moderne Bau- und Stadtplanungstechnologien betrachtet wird", betont Prieto-Curiel.
ZUR STUDIE
Die Studie “Arguments for building The Circle and not The Line in Saudi Arabia” wurde kürzlich im Fachjournal npj Urban Sustainability veröffentlicht.
Die Studie “Arguments for building The Circle and not The Line in Saudi Arabia” wurde kürzlich im Fachjournal npj Urban Sustainability veröffentlicht.
ÜBER DEN COMPLEXITY SCIENCE HUB
Der Complexity Science Hub (kurz: CSH Vienna) wurde mit dem Ziel gegründet, Big Data zum Nutzen der Gesellschaft einzusetzen. Der CSH Vienna bereitet unter anderem große Datensätze systematisch und strategisch so auf, dass Auswirkungen von Entscheidungen in komplexen Situationen vorab getestet und systematisch bewertet werden können. Damit liefert der Complexity Science Hub die Grundlagen für eine evidenzbasierte Politik. https://www.csh.ac.at
Der Complexity Science Hub (kurz: CSH Vienna) wurde mit dem Ziel gegründet, Big Data zum Nutzen der Gesellschaft einzusetzen. Der CSH Vienna bereitet unter anderem große Datensätze systematisch und strategisch so auf, dass Auswirkungen von Entscheidungen in komplexen Situationen vorab getestet und systematisch bewertet werden können. Damit liefert der Complexity Science Hub die Grundlagen für eine evidenzbasierte Politik. https://www.csh.ac.at