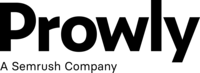Im anhaltenden Kampf gegen Misinformationen hält sich die weitverbreitete Annahme, dass starke Emotionen unser Urteilsvermögen trüben und Menschen anfälliger für falsche Nachrichten machen. Eine neue Studie des Complexity Science Hub (CSH) stellt diese vereinfachte Annahme jedoch infrage und beleuchtet die komplexe Rolle von Emotionen bei der Wahrnehmung und Entscheidungsfindung.
[Wien, 12.03.2025] Die Forschung hat gezeigt, dass Emotionen eine wichtige Rolle dabei spielen, wie wir die Welt interpretieren und Entscheidungen treffen. "Sie sind Teil intelligenten menschlichen Verhaltens", sagt Hannah Metzler, Neurowissenschaftlerin und Psychologin am Complexity Science Hub.
Um die emotionale Dynamik im Zusammenhang mit Misinformationen besser zu verstehen, müssen laut Metzler, die Hauptautorin der Studie ist, verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, die die emotionale Reaktion auf Nachrichten beeinflussen. Dazu gehören zum Beispiel bereits vorhandene Emotionen, der Inhalt der Nachricht und das Vertrauen in die Nachrichtenquelle.
Um die emotionale Dynamik im Zusammenhang mit Misinformationen besser zu verstehen, müssen laut Metzler, die Hauptautorin der Studie ist, verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, die die emotionale Reaktion auf Nachrichten beeinflussen. Dazu gehören zum Beispiel bereits vorhandene Emotionen, der Inhalt der Nachricht und das Vertrauen in die Nachrichtenquelle.
„Wenn man die Emotionen einer Person betrachtet, die eine falsche Schlagzeile liest, und sich fragt, ob die Emotionen dazu führen, dass sie der Nachricht eher glaubt, spielt es eine Rolle, warum sie sich so fühlt – etwa warum die Person wütend ist. Es macht einen großen Unterschied, ob sie zuvor einen Streit mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin hatte oder ob der Inhalt der Schlagzeile sie wütend gemacht hat“, erklärt Metzler.
SCHLAGZEILEN ZU COVID
In der Studie untersuchten Metzler und ihr Team den Zusammenhang zwischen Emotionen und der Fähigkeit, echte von falschen Nachrichten zu unterscheiden, insbesondere im Kontext von Misinformationen zu Covid-19. Dabei wurden sowohl die emotionale Verfassung der Menschen vor dem Lesen der Schlagzeilen – also ihre Stimmung – als auch die durch die Nachrichten ausgelösten Emotionen – ihre emotionale Reaktion – untersucht.
Die Forscher:innen führten ihre Studie im November 2021 mit 422 Teilnehmenden aus Österreich in einer entscheidenden Phase der Covid-19-Pandemie durch, als die Impfkampagnen anliefen. Die Teilnehmenden sahen verschiedene Schlagzeilen mit Bildern und sollten deren Genauigkeit bewerten sowie die Emotionen angeben, die die Nachrichten in ihnen auslösten.
EMOTIONEN BEEINTRÄCHTIGEN DAS URTEILSVERMÖGEN NICHT
Entgegen der weitverbreiteten Annahme, dass Emotionen das Urteilsvermögen beeinträchtigen, hatte die emotionale Verfassung der Teilnehmenden vor dem Lesen der Nachrichten keinen signifikanten Einfluss auf ihre Fähigkeit, falsche Nachrichten zu erkennen.
"Wir fanden keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der emotionalen Verfassung der Teilnehmenden in den Tagen vor dem Anschauen der Nachrichten und ihrer Fähigkeit, wahre von falschen Nachrichten zu unterscheiden", sagt Metzler.
"Eine verbreitete Annahme ist, dass Menschen anfälliger für Misinformationen werden, wenn sie sich ängstlich fühlen, etwa zu Beginn einer Pandemie. Unsere Ergebnisse widersprechen jedoch dieser vereinfachten Vorstellung, dass Emotionen Menschen grundsätzlich weniger rational machen, unabhängig davon, was die Quelle oder der Grund für die Emotion ist."
FALSCHE NACHRICHTEN LÖSTEN WUT AUS
Die durch die Nachricht selbst ausgelösten Emotionen spielten laut der Studie jedoch eine entscheidende Rolle. Falsche Schlagzeilen, insbesondere zu Covid-19-Themen wie der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen oder PCR-Tests, riefen mehr Wut und weniger Freude hervor als echte Nachrichten. Interessanterweise erkannten diejenigen, die auf falsche Nachrichten wütend reagierten, diese häufiger als falsch. Sie brachten ihre Frustration oft mit Begriffen wie "Blödsinn", "Unsinn" oder "Fake News" zum Ausdruck, erläutert Metzler.
Die Studie zeigte zudem, dass die emotionale Reaktion auf Nachrichten oft mit den bestehenden Überzeugungen zu Covid-19 übereinstimmte. Menschen, die weniger fehlerhafte Vorstellungen über Covid-19-Impfstoffe hatten, empfanden beispielsweise mehr Wut gegenüber falschen Nachrichten und weniger gegenüber echten Nachrichten. Das deute darauf hin, dass Emotionen dabei helfen können, zu erkennen, wann Nachrichten nicht mit dem bereits vorhandenen Wissen übereinstimmen, so Metzler.
EMOTIONEN MACHEN NICHT DÜMMER
"Unsere Beobachtungen unterstreichen die Tatsache, dass Menschen Nachrichten so interpretieren, dass sie mit ihren bestehenden Überzeugungen übereinstimmen. Emotionen können eine Rolle dabei spielen, unsere Aufmerksamkeit auf Informationen zu lenken, die für uns relevant sind. Sie machen uns also nicht einfach dümmer, sondern liefern wichtige soziale Informationen, etwa ob wir mit jemandem übereinstimmen oder nicht", erklärt Metzler.
Auch wenn die Studie wertvolle Einblicke liefert, sollte man beachten, dass die in einer Online-Befragung erfassten Emotionen nicht die realen Erfahrungen in vollem Umfang widerspiegeln, ergänzt die CSH-Forscherin. Nachrichten werden oft in dynamischeren und emotional aufgeladenen Umfeldern wie sozialen Medien konsumiert. Metzler und ihr Team erforschen diese Zusammenhänge weiter, um besser zu verstehen, wie Emotionen unser Nachrichtenverhalten im Alltag beeinflussen.
Service
ÜBER DIE STUDIE
Die Studie "Emotions in misinformation studies: distinguishing affective state from emotional response and misinformation recognition from acceptance" von J. Lühring, A. Shetty, C. Koschmieder, D. Garcia, A. Waldherr und H. Metzler wurde kürzlich in Cognitive Research: Principles and Implications veröffentlicht (doi: 10.1186/s41235-024-00607-0).
ÜBER DEN COMPLEXITY SCIENCE HUB
Der Complexity Science Hub (CSH) ist Europas wissenschaftliches Zentrum zur Erforschung komplexer Systeme. Wir übersetzen Daten aus einer Reihe von Disziplinen – Wirtschaft, Medizin, Ökologie, Sozialwissenschaften – in anwendbare Lösungen für eine bessere Welt. Gegründet im Jahr 2016, forschen heute über 70 Wissenschafter:innen am CSH, getragen von der wachsenden Notwendigkeit für ein fundiertes Verständnis der Zusammenhänge, die unserer Gesellschaft zugrunde liegen – vom Gesundheitswesen bis zu Lieferketten. Mit unseren interdisziplinären Methoden entwickeln wir die Kompetenzen, um Antworten auf heutige und zukünftige Herausforderungen zu finden.
Mitglieder des CSH sind AIT Austrian Institute of Technology, BOKU University, Central European University (CEU), IT:U Interdisciplinary Transformation University Austria, Medizinische Universität Wien, TU Wien, TU Graz, Universität für Weiterbildung Krems, Vetmeduni Wien, WU (Wirtschaftsuniversität Wien) und Wirtschaftskammer Österreich (WKO).
csh.ac.at
Mitglieder des CSH sind AIT Austrian Institute of Technology, BOKU University, Central European University (CEU), IT:U Interdisciplinary Transformation University Austria, Medizinische Universität Wien, TU Wien, TU Graz, Universität für Weiterbildung Krems, Vetmeduni Wien, WU (Wirtschaftsuniversität Wien) und Wirtschaftskammer Österreich (WKO).
csh.ac.at